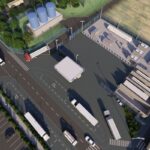Forschungszentrum Jülich weiht Prüfstand für Elektrolyseure ein
Die Anlage sei mit allerhand Sensoren und Kameras ausgestattet. So lassen sich die Prozesse, die im Inneren eines Elektrolyseurs ablaufen, richtig nachvollziehen. Die Ergebnisse sollen zurück an die Hersteller von Elektrolyseuren fließen. Damit sei die Anlage ein wichtiger Schritt für die Wettbewerbsfähigkeit von Elektrolyseuren „made in Germany“.
VGS erhält 61 Millionen Euro für Wasserstoffumwidmung eines Kavernenspeichers
Das Projekt sei das erste, bei dem eine Kaverne in dieser Größenordnung für den Einsatz von Wasserstoff ertüchtigt wird. Robert Habeck reiste für die Übergabe des Fördermittelbescheids an. Bei dem Projekt gehe es auch um die Sicherung des Wirtschaftsstandorts in Mitteldeutschland.
H-Tec Systems startet Serienfertigung von Elektrolyse-Stacks – und bekommt einen neuen Namen
Im neuen Werk in Hamburg können im Vollausbau jährlich PEM-Stacks mit einer Leistung von insgesamt mehr als fünf Gigawatt gefertigt werden. Ab dem 30. September 2024 firmiert die MAN-Tochter unter dem Namen Quest One.
Linde baut 100-Megawatt-Elektrolyseur für Shell
Die Anlage am Shell-Standort in Wessling bei Köln soll 2027 in Betrieb gehen. Shell will mit dem Wasserstoff Kraftstoffe und andere Energieträger klimafreundlicher machen. Zudem liefert Linde zwei 100-Megawatt-Elektrolyseure an RWE.
Wasserstoff-Tankanlage entsteht an RWE-Gaskraftwerk Emsland
Neben der öffentlichen Tankanlage entsteht auch noch eine Abfüllstation. Die ersten Wasserstoffmengen wollen RWE und die Westfalen Gruppe über Ausschreibungen verkaufen.
Thyssenkrupp Nucera korrigiert Wasserstoff-Prognosen nach unten
Die weiterhin spürbare Marktunsicherheit bei der alkalischen Wasserelektrolyse führen zu einer Rücknahme der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2024/25. Langfristig setzt Thyssenkrupp Nucera jedoch hohe Erwartungen in dieses Geschäft.
Bundesregierung beschleunigt Genehmigungsverfahren für Photovoltaik, Windkraft und Speicher
Beschleunigungsgebiete und verkürzte Genehmigungsverfahren sollen für einen schnelleren Ausbau bei Wind- und Solarparks sowie Energiespeicher am selben Standort sorgen. Es werden damit Vorgaben aus der EU-Erneuerbaren-Energien-Richtlinie des Jahres 2023 umgesetzt. Auch für Elektrolyseure zum Hochlauf der Wasserstoff-Erzeugung werden Genehmigungen erleichtert.
Fraunhofer IEG: Neue Versuchsanlage zur gleichzeitigen Effizienzsteigerung von Elektrolyseuren und Wärmepumpen
Die Stadt Zittau erteilte nun die Baugenehmigung für die Testanlage, die bis Anfang kommenden Jahres entstehen soll. Es geht um die Entwicklung von kostengünstigen Elektrolyseuren für die Herstellung von grünem Wasserstoff, bei denen auch die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme wirtschaftlich genutzt werden.
Projekt „MarrakEsH“: DC-Kopplung für mehr grünen Wasserstoff
Sechs Partner aus Industrie und Forschung entwickeln und erproben neue Technologien für eine autarke Energieerzeugung und -speicherung mittels grünem Wasserstoff. Durch eine direkte DC-Kopplung verschiedener Erzeuger und Speicher wie Photovoltaik-Anlagen, Batterien und Brennstoffzellen soll die Effizienz und Leistungsdichte des Gesamtsystems erhöht werden.
EU-Rechnungshof fordert Realitätscheck bei der Wasserstoffstrategie
Überambitioniert und ohne analytische Grundlage, so das Fazit der obersten Prüfer der EU zur Wasserstoff-Strategie. Trotz der gewaltigen Fördersumme von 18,8 Milliarden Euro sei nicht zu erwarten, dass die EU auch nur die Hälfte des Ziels für Wasserstoff-Produktion und den Import bis 2030 erreicht.